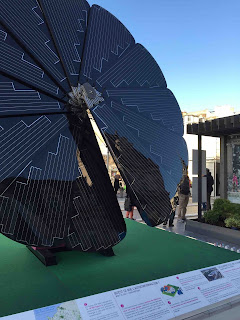Das Parlament mag zwar nach rechts gerückt sein. Dass seine Entscheide in Zukunft konservativer ausfallen, ist dagegen nicht zu erwarten. Foto: Keystone
Seit Ende November ist die neue Bundesversammlung komplett. Damit lassen sich auch die politischen Profile der beiden Räte verlässlich vergleichen: Bei welchen Themen besteht Einigkeit, wo liegt Konfliktpotenzial, und wie ist die Entwicklung seit den Wahlen von 2011 einzuschätzen? Bisherige Einordnungen der Wahlergebnisse vom Oktober haben den Ständerat zumeist ausser Acht gelassen.
Einerseits sind mehr als ein Drittel der Sitze zunächst unbesetzt geblieben. Anderseits geniessen die Ständeratsmitglieder aufgrund der Majorzwahl oft eine erhöhte Unabhängigkeit von ihrer Parteiführung. So fällt denn auch das Wahlergebnis bei der kleinen Kammer weniger eindeutig aus als beim Nationalrat: Zwar hat ebenfalls eine Stärkung rechtsbürgerlicher Parteien stattgefunden, anders als im Nationalrat sind diese jedoch weit von einer Mehrheit entfernt.
Eine rein parteiarithmetische Sichtweise ist aber ohnehin unsinnig. Etliche CVP-Ständeräte, so zum Beispiel die beiden Walliser, sind deutlich rechtsbürgerlich positioniert. Demgegenüber finden sich in der FDP zwei Linksfreisinnige aus der Romandie. Bekannt ist auch, dass die SP-Politiker Claude Janiak, Daniel Jositsch und Pascale Bruderer nicht immer der Parteilinie folgen. Gleiches gilt für einige SVP-Ständeräte. Der Schaffhauser Thomas Minder schliesslich, obwohl Teil der SVP-Fraktion, agiert autonom. Mit dem parteipolitischen Zählrahmen ist das Profil des Ständerats also nicht zu erfassen.
Konflikte zwischen den Räten
Ein realitätsnahes Bild ergeben daher einzig die konkreten politischen Positionsbezüge. Um herauszufinden, ob der neue Ständerat den Positionen des Nationalrats folgt oder vermehrt sein eigenes Süppchen kocht, bieten die Antworten der gewählten Parlamentarier auf die 75 Fragen der Online-Wahlhilfe Smartvote eine gute Datenbasis.
Die Auswertung belegt: Die voraussichtlichen Mehrheitspositionen im National- und im Ständerat unterscheiden sich nur bei acht Smartvote-Fragen. Allein diese Zahl verdeutlicht, dass ernsthafte Blockaden zwischen den Kammern kaum zum Alltag der kommenden Legislatur gehören werden. Relevanter als die blosse Anzahl ist die politische Bedeutung der Themen, bei denen Differenzen zutage treten. So wird etwa bei folgenden wichtigen Fragen wahrscheinlich Uneinigkeit bestehen:
Erhöhung des Rentenalters: Die Befürworter einer Erhöhung haben im Nationalrat eine eher knappe Mehrheit, während im Ständerat ein Nein resultiert. Die Chancen, dass der Ständerat der Rentenaltererhöhung im Rahmen einer Paketlösung bei der AHV-Reform zustimmt, sind indes intakt. Die kleine Kammer befindet sich somit in einer guten Position, um bei der Ausgestaltung dieser Paketlösung ihren Stempel aufzudrücken.
Steuersenkungen: Eine ebenfalls relativ knappe Mehrheit unter den Nationalratsmitgliedern befürwortet Steuersenkungen auf Bundesebene. Im Ständerat sind die Vorzeichen umgekehrt. Spürbare Steuerentlastungen dürften es auch wegen der düsteren finanziellen Aussichten des Bundes für die nächsten Jahre eher schwer haben.
Liberalisierung der Geschäftsöffnungszeiten: Eine Deregulierung der Ladenöffnungszeiten ist im Nationalrat mehrheitsfähig, im Ständerat hingegen ist diese kaum durchzubringen. Der Nationalrat dürfte daher die hängige Vorlage zur teilweisen Liberalisierung annehmen, der Ständerat zum wiederholten Male ablehnen.
Verschärfung des Jugendstrafrechts: Eine knappe Mehrheit der grossen Kammer würde längere Haftstrafen in geschlossenen Anstalten für jugendliche Straftäter befürworten. Eine ebenso knappe Mehrheit im Ständerat lehnt dies ab. Wie sich das Parlament im konkreten Fall entscheiden würde, ist daher völlig offen.
Akzentverschiebung nach rechts
Aufschlussreich ist zudem der Vergleich mit den vorletzten Wahlen von 2011. Aufgrund der Auswertung der damaligen Smartvote-Antworten waren 2011 beide Räte noch klar gegen eine Rentenaltererhöhung. Auch Forderungen nach Steuersenkungen auf Bundesebene oder für eine Verschärfung des Jugendstrafrechts verfügten in keiner der beiden Kammern über eine Mehrheit. Sozialstaats- und Umweltschutzanliegen werden es im neuen Parlament schwerer haben als bisher; dies zeigt sich unter anderem daran, dass sich die im Ständerat 2011 noch mögliche Mehrheit zugunsten einer Einführung von Familien-Ergänzungsleistungen inzwischen verflüchtigt hat.
Die politische Verschiebung im Nationalrat zeigt sich auch am Beispiel der Schutzbestimmungen für Grossraubtiere. Nach den vorletzten Wahlen war die grosse Kammer gemäss Smartvote-Antworten noch mehrheitlich gegen eine Aufweichung. Nach den Wahlen 2015 spricht sich in beiden Räten eine Mehrheit dafür aus.
Bilaterale haben weiter Vorrang
Insgesamt betrachtet, dürfte es speziell im Nationalrat erneut eine Legislatur der knappen Mehrheiten werden – diesmal mit leichten Vorteilen für Mitte-rechts. Das Parlament mag zwar nach rechts gerückt sein. Dass seine Entscheide in Zukunft konservativer ausfallen, ist dagegen nicht zu erwarten. Dies zeigt sich bei gesellschaftspolitischen Themen, aber auch bei solchen mit aussen- und migrationspolitischem Bezug. So haben Erleichterungen bei der Einbürgerung von Ausländern der dritten Generation in beiden Räten gute Chancen. Auch die vermehrte Aufnahme von Kontingentsflüchtlingen findet im Ständerat eine relativ klare Mehrheit, die grosse Kammer lehnt sie nur noch knapp ab. Beim Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare und der aktiven Sterbehilfe ist im Vergleich zu 2011 zumindest eine deutliche Tendenz zu gesellschaftsliberaleren Haltungen erkennbar.
Eine klare Kante zeigt das Parlament in den aussenpolitischen Schicksalsfragen der nächsten Jahre: Der Vorrang der Europäischen Menschenrechtskonvention, das Schengen-Abkommen und die Priorität der Bilateralen gegenüber der strikten Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative sind im National- und Ständerat nach wie vor unbestritten.
* Daniel Schwarz ist Co-Projektleiter der Wahlplattform Smartvote. Die Studie basiert auf den politischen Profilen von 188 Nationalrats- und 41 Ständeratsmitgliedern. Fehlende Profile wurden durch den Mittelwert der jeweiligen Fraktion ersetzt.
Quelle: Tages-Anzeiger 23.11.16
^^^ Nach oben



 «SonntagsZeitung»-Chef Arthur Rutishauser (l.) übernimmt den «Tages-Anzeiger» von Res Strehle. Fotos: TA
«SonntagsZeitung»-Chef Arthur Rutishauser (l.) übernimmt den «Tages-Anzeiger» von Res Strehle. Fotos: TA  Das Geldschöpfungsmonopol der Notenbanken ist auf das Bargeld beschränkt. Foto: Martin Rütschi (Keystone)
Das Geldschöpfungsmonopol der Notenbanken ist auf das Bargeld beschränkt. Foto: Martin Rütschi (Keystone)